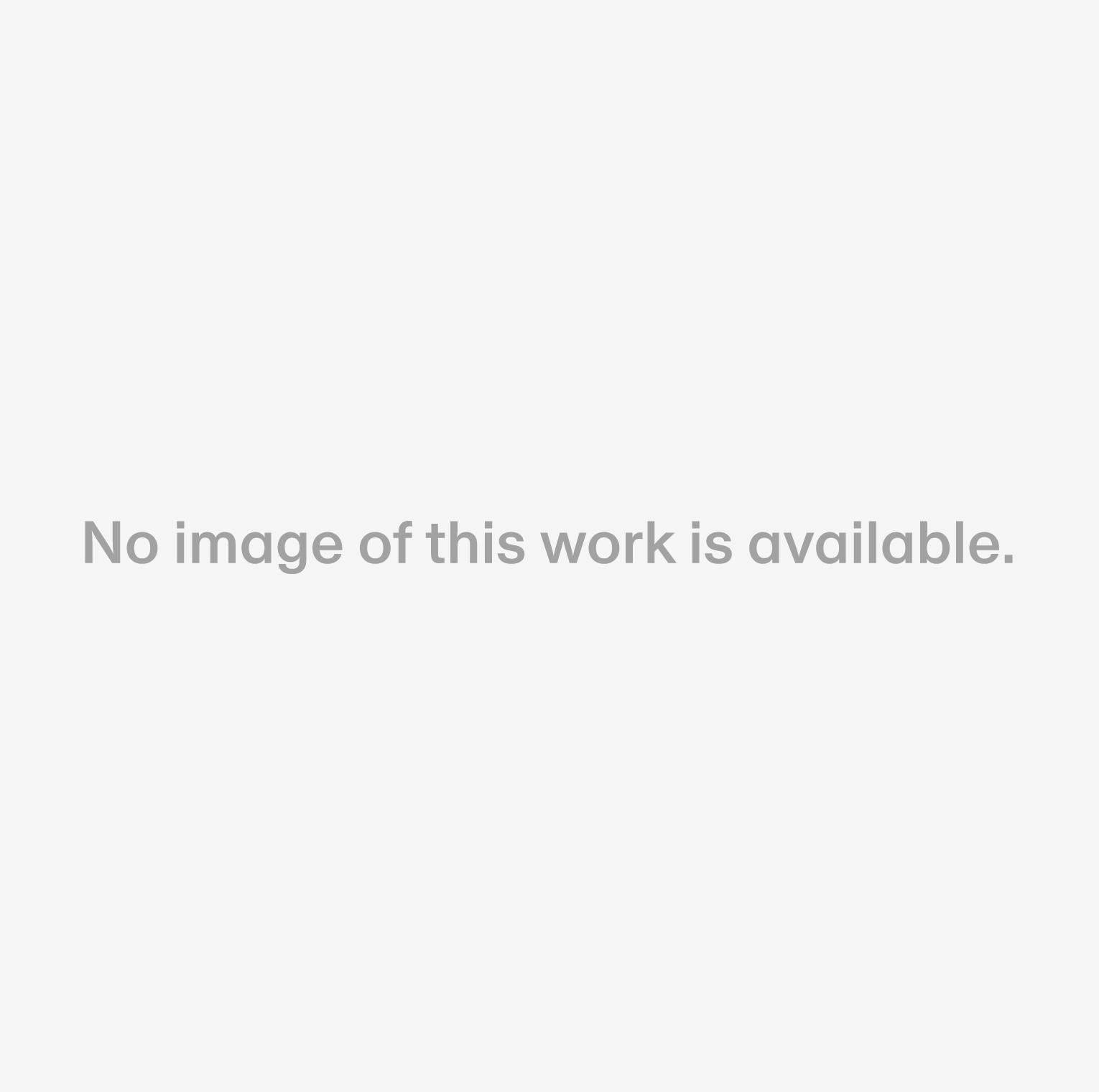Klaus Lutz
Klaus Lutz (1940, St. Gallen, CH – 2009, New York, USA) hat der Kunstwelt ein im besten Sinn eigenwilliges Werk hinterlassen, das zur Hauptsache Film, Zeichnung und Druckgrafik umfasst. Entstanden ist es zunächst in Zürich, unterbrochen von einem längeren, durch ein Atelierstipendium eingeleiteten Aufenthalt in Genua. 1993 zog Lutz, wieder mit Stipendium, nach New York, wo er blieb und ab 1994 in einem bescheidenen Apartment im East Village lebte, das ihm, schwarz bespannt, zugleich als Filmstudio diente. In dieser camera cum vitro schuf er mit knappsten Mitteln und viel Gespür für die Möglichkeiten des 16-mm-Formats seine Filme, für die er auf der Grundlage seiner Zeichnungen und fein getakteter Protokolle mit aufwendigen analogen Verfahren experimentierte. Zur bevorzugten Methode wurde es, sich selbst mit Speziallinsen aufzunehmen und sich so als kleine Figur mittels Doppelbelichtung in die grafischen Sequenzen einzubringen. Dies ergab im Wechsel mit normal gefilmten Passagen halb traumwandlerisch, halb konstruktivistisch anmutende Animationen, für die der Künstler auch räumliche und performative Präsentationsformen konzipierte.
Um dem Betrachter die Möglichkeit zu geben, die temporeichen Bildwelten eingehender zu studieren, fertigte Lutz nach einigen seiner Filme ferner Standbilder an. Die beiden C-Prints in der Sammlung stammen aus dem 1996 im Swiss Institute uraufgeführten Film «Acrobatics» (Farbe, ohne Ton, 21½ bzw. 16 Min. bei 18 bzw. 24 B/S), der auf die Flughöhen des Lebens und Überlebens in «Nethermanhattan» anspielt. Film und Fotos zeigen den Künstler als Kunstfigur, die im weissen Overall, alles Individuelle abstreifend, quasi schwerelos vor nachtschwarzem Grund zwischen Raumlinien und geometrischen Elementen herumturnt oder diese manipuliert. Das Geschehen wirkt zeichenhaft-selbstreferenziell und gibt seine verzweigten literarischen oder kulturhistorischen Hintergründe nur auf Umwegen preis. Hilfestellung bieten dabei weitere Werktitel wie «Almagest» oder «Marsschatten», die über das Selbsterklärende von «Acrobatics» hinausgehen und den Kosmos des Künstlers mit anderen, antiken wie zeitgenössischen Weltbildern und Vorstellungswelten verbinden. Auch kunst- und filmhistorische Bezüge spielen hinein, etwa zur Arbeitsweise des französischen Cineasten Georges Méliès und seinem bekanntesten Film «Le voyage dans la lune» (1902), aber auch ganz allgemein zum Film am Übergang vom Attraktions- zum Erzählkino oder, etwas später, zu den grafisch aufbereiteten Agitprop-Materialien der russischen Avantgarde. Technisch handelt es sich um Stills, die Lutz vom projizierten Film abfotografiert und als Doppelbild, bestehend aus zwei Kadern derselben Sequenz, abgezogen hat (die Zahlen in Klammern entsprechen den Labor- und Einzelbildnummern des fotografischen Negativmaterials). Anders als beim Filmfluss, der die Handlung betont, liegt somit der Fokus auf den strukturellen Qualitäten des Bildes. Darauf verweist auch der in drei der vier Einzelbilder vorkommende weisse Rahmen sowie die senkrechte Montage, die nicht umsonst an das Aussehen analoger Filmstreifen erinnert.
Astrid Näff
Um dem Betrachter die Möglichkeit zu geben, die temporeichen Bildwelten eingehender zu studieren, fertigte Lutz nach einigen seiner Filme ferner Standbilder an. Die beiden C-Prints in der Sammlung stammen aus dem 1996 im Swiss Institute uraufgeführten Film «Acrobatics» (Farbe, ohne Ton, 21½ bzw. 16 Min. bei 18 bzw. 24 B/S), der auf die Flughöhen des Lebens und Überlebens in «Nethermanhattan» anspielt. Film und Fotos zeigen den Künstler als Kunstfigur, die im weissen Overall, alles Individuelle abstreifend, quasi schwerelos vor nachtschwarzem Grund zwischen Raumlinien und geometrischen Elementen herumturnt oder diese manipuliert. Das Geschehen wirkt zeichenhaft-selbstreferenziell und gibt seine verzweigten literarischen oder kulturhistorischen Hintergründe nur auf Umwegen preis. Hilfestellung bieten dabei weitere Werktitel wie «Almagest» oder «Marsschatten», die über das Selbsterklärende von «Acrobatics» hinausgehen und den Kosmos des Künstlers mit anderen, antiken wie zeitgenössischen Weltbildern und Vorstellungswelten verbinden. Auch kunst- und filmhistorische Bezüge spielen hinein, etwa zur Arbeitsweise des französischen Cineasten Georges Méliès und seinem bekanntesten Film «Le voyage dans la lune» (1902), aber auch ganz allgemein zum Film am Übergang vom Attraktions- zum Erzählkino oder, etwas später, zu den grafisch aufbereiteten Agitprop-Materialien der russischen Avantgarde. Technisch handelt es sich um Stills, die Lutz vom projizierten Film abfotografiert und als Doppelbild, bestehend aus zwei Kadern derselben Sequenz, abgezogen hat (die Zahlen in Klammern entsprechen den Labor- und Einzelbildnummern des fotografischen Negativmaterials). Anders als beim Filmfluss, der die Handlung betont, liegt somit der Fokus auf den strukturellen Qualitäten des Bildes. Darauf verweist auch der in drei der vier Einzelbilder vorkommende weisse Rahmen sowie die senkrechte Montage, die nicht umsonst an das Aussehen analoger Filmstreifen erinnert.
Astrid Näff
Werke von Klaus Lutz